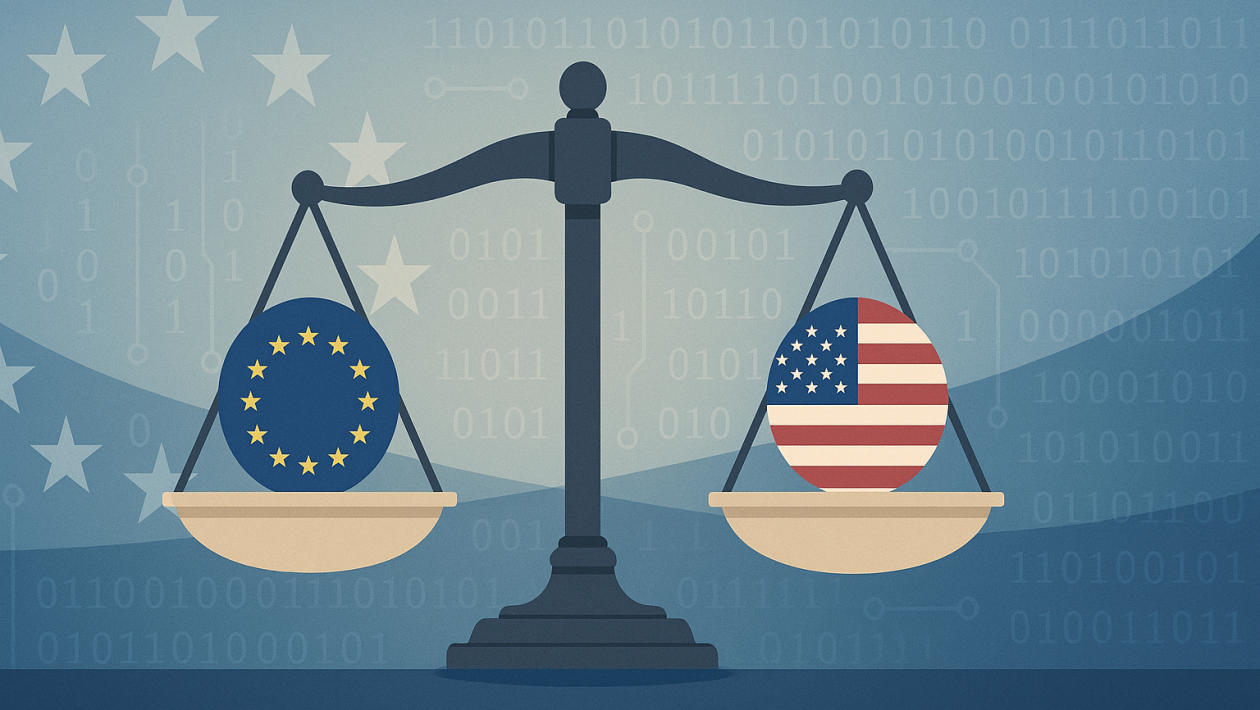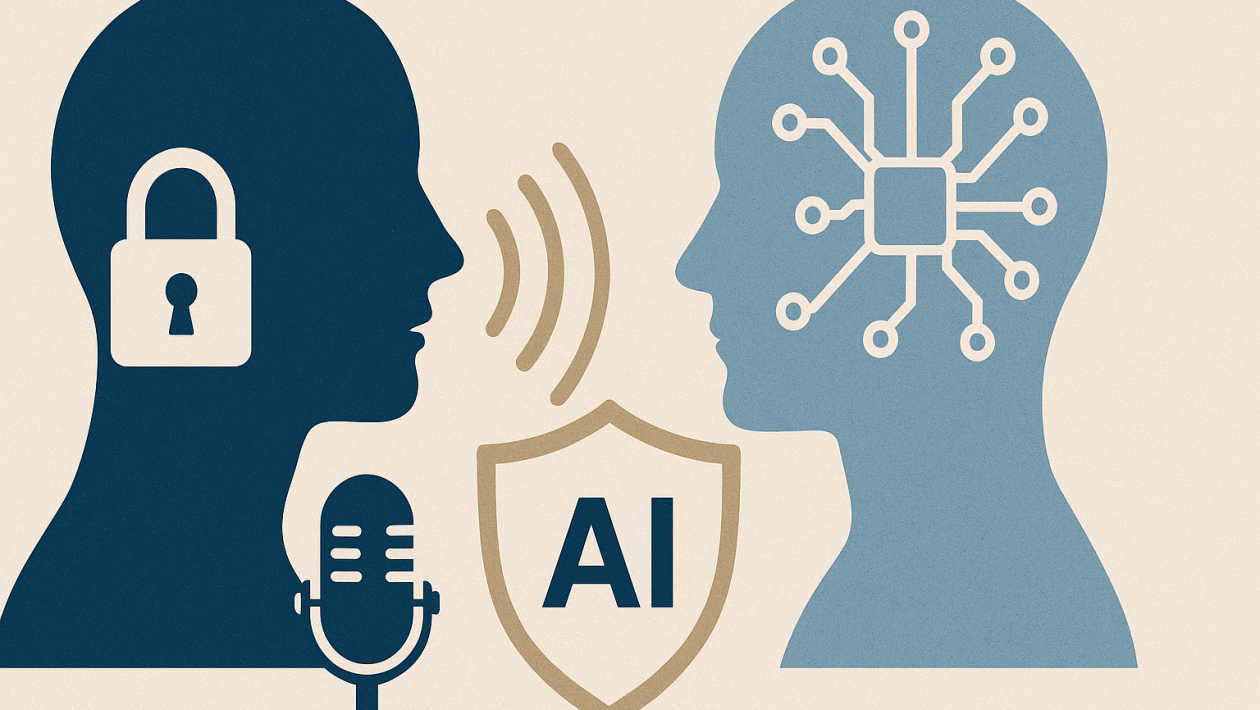Mit dem Inkrafttreten des Digital Services Act (DSA) stellt sich die Frage, wie dessen Vorgaben mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) harmonieren. Der Europäische Datenschutzausschuss (EDSA) hat hierzu jetzt Leitlinien veröffentlicht, die Unternehmen helfen sollen, beide Regelwerke rechtskonform umzusetzen. Die Leitlinien sind Gegenstand einer öffentlichen Konsultation bis zum 31. Oktober 2025. Die Vorsitzende des EDSA, Anu Talus, erklärte hierzu, dass diese Leitlinien