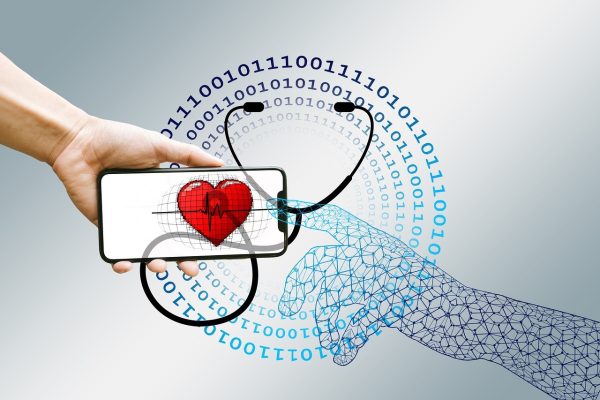Posteingang Aristoteles trifft KI White Paper des Instituts für Ethik in AI der Oxford Universität Das Institute für Ethics in AI der Universität Oxfort bringt führende Philosophinnen und Philosophen sowie andere Expertinnen und Experten aus den Geisteswissenschaften mit den technischen Entwicklerinnen und Entwicklern sowie Anwendern von KI in Wissenschaft, Wirtschaft und Regierung zusammen Das aristotelische Rahmenkonzept – menschliche Natur, Ethik